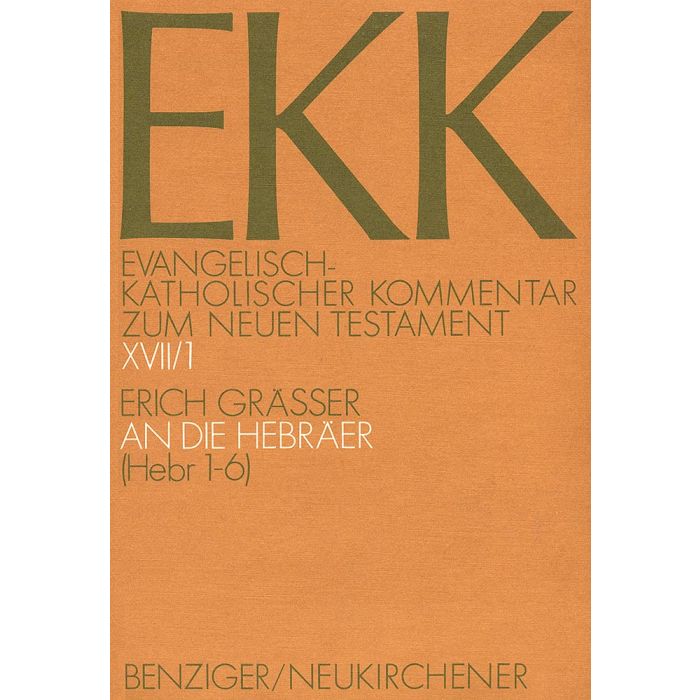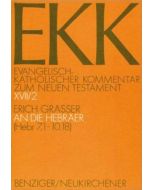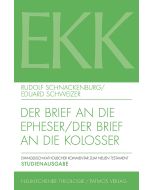Details stehen in den Datenschutzhinweisen.
Der Brief an die Hebräer
EKK XVII/1, Hebr 1-6
Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament EKK
69,00 €
Inkl. 7% MwSt. ,
exkl. Versandkosten
Auf Lager
lieferbar
Inhalt
Der Hebräerbrief ist unter den Schriften des Neuen Testaments ein ziemlicher Außenseiter. Seine ganz eigenwillige theologische Denkweise gilt als schwierig, die Verweigerung der »zweiten Buße« noch immer als »harter Knochen« (M. Luther). Die historischen Entstehungsverhältnisse liegen weithin im dunkeln. Und die theologische Leistung schwankt im Urteil der Fachgelehrten.
In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch mehr und mehr die Überzeugung durchgesetzt, daß der unbekannte Verfasser dieser frühchristlichen Schrift ein theologischer Kopf gewesen sein muß, der sich hinter Paulus oder Johannes nicht zu verstecken braucht. Ihm gelingt es, im Wandel der Geschichte das alte Bekenntnis so zu aktualisieren, daß es bis heute gehört werden kann. Insofern ist der Hebräerbrief ein Muster an theologischer Hermeneutik.
Die vorliegende Auslegung ist in erster Linie um das theologische Verständnis bemüht. Der Weg zu diesem Ziel führt über eine möglichst genaue philologische Exegese und die Aufhellung der traditions- und religionsgeschichtlichen Zusammenhänge. Auf diese Weise tritt das besondere theologische Profil des Hebräerbriefs hervor, das von einem unverkennbaren seelsorgerlichen Interesse gesteuert ist: Der Verfasser unserer »Mahnrede« will einer von langer Glaubenswanderschaft müde und verzagt gewordenen Christenheit Mut zum Durchhalten machen, indem er ihr Bekenntnis in der Länge, in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe neu vermißt.
Wir stehen vor dem bemerkenswerten Versuch, eine Glaubenskrise zu bewältigen durch – bessere Theologie. Das könnte die heutige Christenheit aufmerken lassen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch mehr und mehr die Überzeugung durchgesetzt, daß der unbekannte Verfasser dieser frühchristlichen Schrift ein theologischer Kopf gewesen sein muß, der sich hinter Paulus oder Johannes nicht zu verstecken braucht. Ihm gelingt es, im Wandel der Geschichte das alte Bekenntnis so zu aktualisieren, daß es bis heute gehört werden kann. Insofern ist der Hebräerbrief ein Muster an theologischer Hermeneutik.
Die vorliegende Auslegung ist in erster Linie um das theologische Verständnis bemüht. Der Weg zu diesem Ziel führt über eine möglichst genaue philologische Exegese und die Aufhellung der traditions- und religionsgeschichtlichen Zusammenhänge. Auf diese Weise tritt das besondere theologische Profil des Hebräerbriefs hervor, das von einem unverkennbaren seelsorgerlichen Interesse gesteuert ist: Der Verfasser unserer »Mahnrede« will einer von langer Glaubenswanderschaft müde und verzagt gewordenen Christenheit Mut zum Durchhalten machen, indem er ihr Bekenntnis in der Länge, in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe neu vermißt.
Wir stehen vor dem bemerkenswerten Versuch, eine Glaubenskrise zu bewältigen durch – bessere Theologie. Das könnte die heutige Christenheit aufmerken lassen.
Mehr Informationen
| Auflage | 1. Auflage 1994 |
|---|---|
| Einband | Paperback |
| Seitenzahl | 388 |
| Format | 16,4 x 24 cm |
| ISBN/EAN | 978-3-545-23120-7 |
| VGP-Nr. | 123120 |
Autor

 Ulrich Luz (Hg.)
Ulrich Luz (Hg.)